Projekt Sternenpark Pfälzerwald vergibt Zertifikat für den Schutz der natürlichen Nacht
„Es ist hier von Natur aus sehr dunkel, wir liegen selbst gerne auf der Wiese und genießen den Sternenhimmel“, sagt Dennis Müller, der seit Anfang 2019 das Forsthaus Merzalben als Hostel betreibt. Als erster Gastgeber ist er für seinen Einsatz für die Bewahrung der natürlichen Nacht im Pfälzerwald mit dem Zertifikat „Gastgeber unter den Sternen“ ausgezeichnet worden, das das Biosphärenreservat Pfälzerwald im Rahmen seines Sternenpark-Projekts vergibt. Gastgeber-Betriebe können durch eine angepasste Beleuchtung, aber auch durch Veranstaltungen für sternenbegeisterte Gäste oder die Vernetzung mit Astronomieakteuren und -akteurinnen punkten, um die Auszeichnung zu erhalten.

„Bei der Übernahme des Hauses habe ich festgestellt, dass eine abendliche und nächtliche Beleuchtung draußen eigentlich nicht notwendig ist. Es ist schön, so wie es ist.“, erläutert Müller. Das schafft gute Voraussetzungen für Sternenguckerinnen und Sternengucker. „Fledermäuse und Eulen fühlen sich hier auch wohl“, ergänzt der Gastgeber. Im Forsthaus Merzalben stehen fünf Zimmer bis zu 15 Personen zur Verfügung. „Es sind vor allem Wanderer und Erholungssuchende, die bisher zu uns kamen“, berichtet Müller, der sich darauf freut, wieder Gäste begrüßen zu dürfen, sobald es die Pandemie-Situation erlaubt. Michael Köhler, Bürgermeister von Merzalben, sagt: „Wir als Gemeinde sind froh, dass Dennis das Hostel hier betreibt.“ Es gebe noch Ideen für eine ans Hostel angegliederte Gastronomie, verraten Köhler und Müller. „Das wäre für Einheimische und Gäste gut“, so der Bürgermeister. Dr. Friedericke Weber, Direktorin des Biosphärenreservats, dankte Dennis Müller für sein Engagement: „Für uns im Biosphärenreservat ist es wichtig, Aktive zu haben, Gastgeberinnen und Gastgeber, Gemeinden und viele andere, die die Idee des Biosphärenreservats weitertragen.“
Projekt Sternenpark Pfälzerwald und Zertifikat „Gastgeber unter den Sternen“
Aufgrund von Industrialisierung, Zersiedelung und anderen Faktoren herrscht nur noch an wenigen Orten in Europa nach Sonnenuntergang natürliche Dunkelheit. Der Pfälzerwald jedoch weist noch Gebiete mit nahezu natürlichen Nachtlandschaften und einem sternenreichen Himmel auf. Diese Gebiete sind wichtig und wertvoll, weil sie neben der Schönheit des Sternenhimmels auch Lebensraum für zahlreiche tag- und nachtaktive Tiere und Pflanzen bieten.
Das Projekt „Sternenpark Pfälzerwald“ will solche Gebiete mit nahezu intakten Nachtlandschaften erhalten und fördern. Das Projekt will für den Schutz der natürlichen Nacht sensibilisieren und zeigen, wie man eine Reduzierung der Lichtverschmutzung durch sternen- und gleichermaßen umweltfreundliche Beleuchtung im Pfälzerwald mit Energie- und Kosteneinsparungen verbinden kann. Von einer Sanierung der Straßen- und Außenbeleuchtung profitieren Mensch und Natur gleichermaßen.
Neben der Auszeichnung „Gemeinde unter den Sternen“, die kürzlich erstmals an die Gemeinde Rumbach für den Einsatz einer sternen- und tierfreundlichen Beleuchtung vergeben wurde, richtet sich das Zertifikat ,,Gastgeber unter den Sternen‘‘ an Gastgeber in Hotels oder auch Ferienwohnungen. Die Inhaber des Zertifikates leisten einen wichtigen Beitrag zur Reduzierung der Lichtverschmutzung im Pfälzerwald und machen die Region für astronomisch interessierte Gäste attraktiver. Das Zertifikat wird in den drei Stufen Bronze, Silber und Gold vergeben.
Durch die öffentlichkeitswirksame Vergabe des Zertifikates „Gastgeber unter den Sternen“ wird dieser Einsatz gewürdigt. Über die Internetseite des Projektes werden die Zertifikatsinhaber zusätzlich gelistet und ihre Arbeit beschrieben. Generell kommen als „Gastgeber unter den Sternen“ Betriebe mit und ohne Übernachtungsmöglichkeiten in Frage. Andere Gastgeber sind dazu eingeladen, sich ebenfalls als ,,Gastgeber unter den Sternen‘‘ zu bewerben und somit einen natürlichen Nachthimmel als besonderes Merkmal des Pfälzerwaldes und als Kulturgut für folgende Generationen zu erhalten und Ihren Gästen näherzubringen. Die nötigen Schritte, um als Gastronomiebetrieb ein „Gastgeber unter den Sternen“ anerkannt zu werden und eine wichtige Multiplikatorenfunktion zu übernehmen, gibt es unter www.pfaelzerwald.de/sternenpark.
Das Projekt Sternenpark Pfälzerwald wird als LEADER-Projekt im Rahmen des Entwicklungsprogramms EULLE unter Beteiligung der Europäischen Union und des Landes Rheinland-Pfalz (vertreten durch das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau) gefördert.





 Hobbygärtnerinnen und -gärtner können sich derzeit für den Wettbewerb im Projekt „Gärten für die Artenvielfalt – Jardiner pour la biodiversité“ des Biosphärenreservats Pfälzerwald-Nordvogesen anmelden. Das Projekt will die breite Öffentlichkeit für die Artenvielfalt im Alltag sensibilisieren und so dazu anregen, auch in den bebauten Flächen des Biosphärenreservats, in unseren Städten und Dörfern, ökologisch zu handeln.
Hobbygärtnerinnen und -gärtner können sich derzeit für den Wettbewerb im Projekt „Gärten für die Artenvielfalt – Jardiner pour la biodiversité“ des Biosphärenreservats Pfälzerwald-Nordvogesen anmelden. Das Projekt will die breite Öffentlichkeit für die Artenvielfalt im Alltag sensibilisieren und so dazu anregen, auch in den bebauten Flächen des Biosphärenreservats, in unseren Städten und Dörfern, ökologisch zu handeln.




 Naturschutzgroßprojekt… was für ein Wort! Es ist ein langes Wort. Man kann sich viel und gar nichts darunter vorstellen. Und vielleicht denken manche, die Erklärung könnte ziemlich langweilig sein. Mag zwar sein, aber wenn es sich im ersten Moment auch nicht so spannend anhört, ist das Projekt doch ziemlich cool. Hier erklärt euch das Hirtenwege-Team in kleinen und einfachen Schritten dieses riesige Projekt, und zwar mit Hilfe des ABCs. Hier kommen die Buchstaben A bis D – demnächst geht es weiter mit E bis H!
Naturschutzgroßprojekt… was für ein Wort! Es ist ein langes Wort. Man kann sich viel und gar nichts darunter vorstellen. Und vielleicht denken manche, die Erklärung könnte ziemlich langweilig sein. Mag zwar sein, aber wenn es sich im ersten Moment auch nicht so spannend anhört, ist das Projekt doch ziemlich cool. Hier erklärt euch das Hirtenwege-Team in kleinen und einfachen Schritten dieses riesige Projekt, und zwar mit Hilfe des ABCs. Hier kommen die Buchstaben A bis D – demnächst geht es weiter mit E bis H! Chance.natur. Eigentlich chance.natur Bundesförderung Naturschutz. Oh nein, das hört sich echt kompliziert an. Aber es steckt auch viel dahinter. Denn chance.natur betrifft ganz Deutschland! Mit dieser Förderung kann Deutschland in puncto Naturschutz zeigen, was es drauf hat. Es gibt über 84 chance.natur-Projekte in Deutschland und das Projekt „Neue Hirtenwege im Pfälzerwald“ ist eines davon. Förderung bedeutet so was wie Unterstützung von guten Ideen, die Hilfe bei der Umsetzung benötigen. Für die Natur sind Förderungen vom Bund sehr wichtig, weil unsere Natur erhalten bleiben muss. Gäbe es die Bundesförderung nicht, würden viele schützenswerte Landschaften nicht mehr existieren. Die wichtigsten Ziele der chance.natur Bundesförderung Naturschutz sind:
Chance.natur. Eigentlich chance.natur Bundesförderung Naturschutz. Oh nein, das hört sich echt kompliziert an. Aber es steckt auch viel dahinter. Denn chance.natur betrifft ganz Deutschland! Mit dieser Förderung kann Deutschland in puncto Naturschutz zeigen, was es drauf hat. Es gibt über 84 chance.natur-Projekte in Deutschland und das Projekt „Neue Hirtenwege im Pfälzerwald“ ist eines davon. Förderung bedeutet so was wie Unterstützung von guten Ideen, die Hilfe bei der Umsetzung benötigen. Für die Natur sind Förderungen vom Bund sehr wichtig, weil unsere Natur erhalten bleiben muss. Gäbe es die Bundesförderung nicht, würden viele schützenswerte Landschaften nicht mehr existieren. Die wichtigsten Ziele der chance.natur Bundesförderung Naturschutz sind: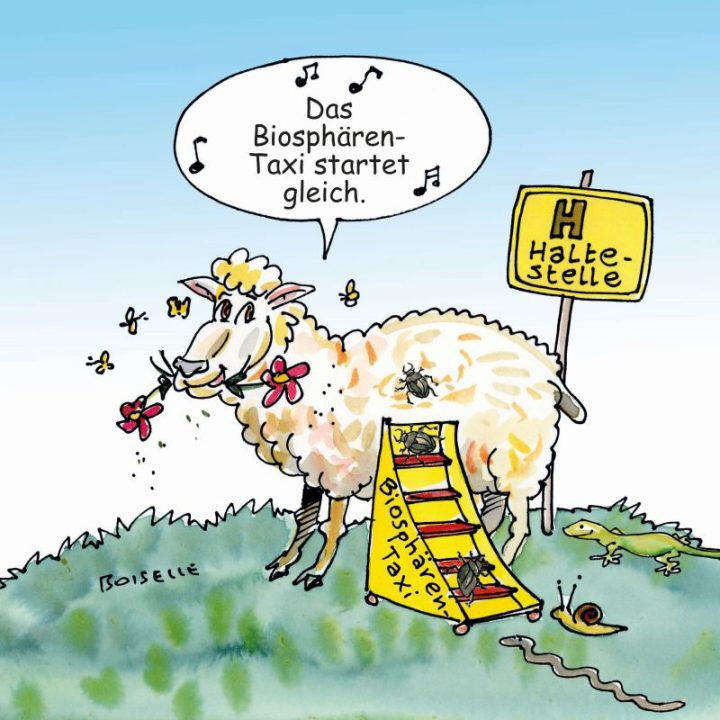 Dienstgang. Dienstgänge müssen viele Leute unternehmen. Ob es das Zeitungaustragen ist oder den Müll rausbringen. Ein Dienstgang im chance.natur-Projekt „Neue Hirtenwege im Pfälzerwald“ sieht wie folgt aus: Man zieht sich Kleidung und Schuhe an, die bequem sind und gegebenenfalls richtig dreckig werden können. Es ist auch immer von Vorteil, wenn man einen Fotoapparat mitnimmt. Dann setzt man sich in den chance.natur-Dienstwagen und ab geht es auf die Flächen! Ein großer Teil der chance.natur-Arbeit findet nämlich auf den Flächen im Fördergebiet (wird unter „F“ erklärt) statt. Hier treffen sich die Akteure und Akteurinnen (Beteiligte) des Projekts, um über die Maßnahmen auf den Flächen zu beraten. Verschiedene Anregungen und Ideen fließen in die Gespräche mit ein. So ein Dienstgang kann kurz sein, aber meistens ist man ein paar Stunden draußen, was eine interessante Abwechslung zur Büroarbeit bietet. Die Interaktion und Kommunikation mit den verschiedenen Beteiligten ist sehr wichtig für das chance.natur-Projekt. Denn das Projekt vernetzt sie miteinander und versucht gemeinsam Lösungen zu finden sowie Herausforderungen zu meistern. Am Ende eines Dienstgangs kann es dann schon mal Abend sein. Wenn dann noch Fotos gemacht werden konnten, ist es einfacher, sich auch im Nachhinein gut an die wichtigsten Inhalte des Dienstgangs zu erinnern.
Dienstgang. Dienstgänge müssen viele Leute unternehmen. Ob es das Zeitungaustragen ist oder den Müll rausbringen. Ein Dienstgang im chance.natur-Projekt „Neue Hirtenwege im Pfälzerwald“ sieht wie folgt aus: Man zieht sich Kleidung und Schuhe an, die bequem sind und gegebenenfalls richtig dreckig werden können. Es ist auch immer von Vorteil, wenn man einen Fotoapparat mitnimmt. Dann setzt man sich in den chance.natur-Dienstwagen und ab geht es auf die Flächen! Ein großer Teil der chance.natur-Arbeit findet nämlich auf den Flächen im Fördergebiet (wird unter „F“ erklärt) statt. Hier treffen sich die Akteure und Akteurinnen (Beteiligte) des Projekts, um über die Maßnahmen auf den Flächen zu beraten. Verschiedene Anregungen und Ideen fließen in die Gespräche mit ein. So ein Dienstgang kann kurz sein, aber meistens ist man ein paar Stunden draußen, was eine interessante Abwechslung zur Büroarbeit bietet. Die Interaktion und Kommunikation mit den verschiedenen Beteiligten ist sehr wichtig für das chance.natur-Projekt. Denn das Projekt vernetzt sie miteinander und versucht gemeinsam Lösungen zu finden sowie Herausforderungen zu meistern. Am Ende eines Dienstgangs kann es dann schon mal Abend sein. Wenn dann noch Fotos gemacht werden konnten, ist es einfacher, sich auch im Nachhinein gut an die wichtigsten Inhalte des Dienstgangs zu erinnern.